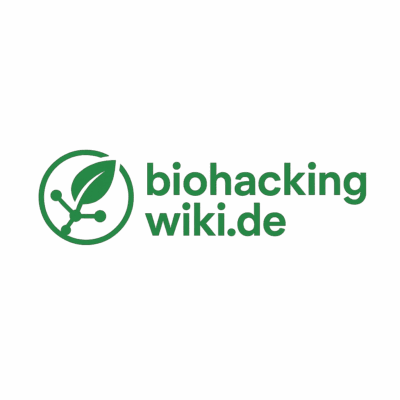Kraft. Klarheit. Langlebigkeit – Die Tsatsouline-Perspektive im Huberman Podcast
Krafttraining im Alter: Manche Menschen laufen Marathon. Andere stemmen Gewichte. Und viele… machen ein paar Sit-ups nach dem Zähneputzen – in der Hoffnung, „auch mal was für den Körper“ getan zu haben.
Was dabei oft unterschätzt wird: Kraft ist nicht nur eine Frage der Muskeln. Sie ist eine Frage der Lebensqualität. Und das gilt nicht nur für Profisportler oder Fitnessjunkies – sondern für jeden Menschen, der gesund alt werden möchte.
Im Huberman Lab Podcast spricht der Neurowissenschaftler Dr. Andrew Huberman mit Pavel Tsatsouline, dem Vater des Kettlebell-Revivals, über genau diese Schnittstelle: Krafttraining als Mittel zur Langlebigkeit.
Was dabei herauskommt, ist keine Fitnesstheorie – sondern ein lebensnaher, fundierter Ansatz, wie man mit erstaunlich einfachen Mitteln seine Kraft, sein Nervensystem und seine Zukunftsfähigkeit trainieren kann. Ohne Muskelkaterwahn. Ohne Gerätepark. Dafür mit System, Klarheit und einem russischen Akzent.
1. Warum ist Krafttraining im Alter so entscheidend?
„Ich will ja keine Bodybuilderin werden“ – diesen Satz hört man oft, wenn es um Gewichte, Muskeln oder Fitnessstudios geht. Verständlich. Doch Krafttraining ist längst kein reines Muskel-Ding mehr. Es geht nicht um Ästhetik. Es geht um Funktion. Und: Es geht ums Überleben.
Denn was passiert mit unserem Körper, wenn wir älter werden?
- Wir verlieren pro Jahrzehnt etwa 3–8 % Muskelmasse – und noch mehr Kraft.
- Die sogenannte sarkopene Adipositas (Fettzunahme bei gleichzeitigem Muskelverlust) ist einer der Hauptfaktoren für Stürze, Gebrechlichkeit und frühzeitige Pflegebedürftigkeit.
- Gleichzeitig sinkt die Sensitivität der Nerv-Muskel-Verbindung. Das führt zu weniger Reaktionsfähigkeit, schlechterer Körperhaltung und einem erhöhten Verletzungsrisiko.
Krafttraining im Alter wirkt hier wie ein biologischer Stoppknopf:
Es verlangsamt nicht nur den Muskelabbau, sondern repariert Verbindungen im Nervensystem, stärkt Knochen, verbessert den Hormonhaushalt (z. B. Testosteron, Wachstumshormon) und wirkt sogar auf das Gehirn – ja, richtig gelesen.
Studien zeigen, dass regelmäßiges Krafttraining:
- die kognitive Leistungsfähigkeit steigert
- die mentale Gesundheit verbessert
- und demenzprotektiv wirkt (1).
Klingt nach einem ziemlich guten Deal für ein paar Minuten Training, oder?
Pavel Tsatsouline bringt es so auf den Punkt:
„Strength is the mother of all physical qualities.“
Ohne Kraft keine Ausdauer, keine Balance, keine Stabilität – und schon gar kein sicheres Altern.
Krafttraining im Alter ist damit kein Lifestyle – es ist eine Investition in deine Zukunftsfähigkeit.
Je eher du beginnst, desto mehr bekommst du zurück.
2. Was sagen Huberman und Tsatsouline über Kraft und Langlebigkeit?
Als Andrew Huberman – Neurowissenschaftler, Professor in Stanford und bekannt für seine wissenschaftlich fundierten Deep Dives – Pavel Tsatsouline zum Interview einlud, wurde schnell klar: Hier treffen Wissenschaft und jahrzehntelange Trainingserfahrung aufeinander.
Ihr zentrales Thema: Kraft als zentraler Baustein für Langlebigkeit – aber eben nicht um jeden Preis.
Was dabei besonders auffiel:
- Krafttraining muss nicht weh tun, um zu wirken.
- Es muss auch nicht viel Zeit kosten.
- Und es darf – laut Tsatsouline – sogar „leicht“ wirken, solange es neurologisch präzise und sauber ausgeführt wird.
Huberman ergänzt die physiologische Sichtweise:
- Krafttraining erhöht die Dichte der neuromuskulären Synapsen – also die Effizienz der Kommunikation zwischen Gehirn und Muskulatur.
- Es stärkt die Plastizität des motorischen Kortex, was wiederum Bewegungskoordination und Reaktionsgeschwindigkeit verbessert.
- Und es aktiviert über das autonome Nervensystem Prozesse, die Entzündungen reduzieren und die Regeneration fördern.
Tsatsouline bringt zudem ein spannendes Konzept ein:
Krafttraining als Anti-Glykolytisches Systemtraining – das heißt: Training ohne übermäßige Milchsäureproduktion, ohne „Brennen“, dafür mit sauberem, wiederholbarem Reiz, der das Nervensystem schult und den Körper nicht auslaugt.
Longevity durch Kraft bedeutet für beide:
- Trainiere nicht bis zum Muskelversagen.
- Höre auf dein Nervensystem, nicht auf dein Ego.
- Und entwickle Routinen, die du dein ganzes Leben lang durchziehen kannst – nicht nur in der Neujahrswoche.
In anderen Worten:
Du brauchst kein „Beastmode“, du brauchst Beständigkeit.
3. Wie funktioniert das Training nach Tsatsouline?
Du denkst bei Krafttraining an brennende Muskeln, klatschende High-Fives und die letzte Wiederholung „mit allem, was du hast“?
Vergiss das kurz. Denn Tsatsouline sieht das anders.
Und zwar radikal anders.
Für ihn ist echtes Krafttraining keine heroische Quälerei, sondern ein präzise gesteuertes, neurologisches Skill-Training. Vergleichbar mit dem Erlernen eines Musikinstruments.
Oder wie er selbst sagt:
„Strength is a skill.“
„Du würdest doch auch nicht versuchen, Klavierspielen zu lernen, indem du einfach draufhaust, bis dir die Finger brennen.“
Sein Prinzip heißt „Grease the Groove“ – auf Deutsch etwa: „die Rille ölen“.
Das bedeutet:
- Du wiederholst eine Bewegung oft,
- aber nie bis zur Erschöpfung.
- Du bleibst unter deinem Limit,
- aber mit maximalem Fokus auf Ausführung, Körperspannung und Atmung.
Das Ziel?
Nicht den Muskel maximal erschöpfen, sondern die neuronale Ansteuerung verfeinern.
Der Muskel „lernt“, präzise Kraft zu erzeugen. Das Nervensystem wird effizienter.
Du wirst stärker – ohne kaputt zu gehen.
Andrew Huberman bestätigt das aus neurophysiologischer Sicht:
- Die Wiederholung von Bewegungsmustern mit hoher Qualität fördert die sogenannte myelinbasierte Bahnung im Gehirn – also das „Einbrennen“ effizienter Bewegungsabläufe.
- Gleichzeitig reduziert sauberes, submaximales Training die Stresslast, die das autonome Nervensystem (besonders den Sympathikus) überlasten würde.
- Das führt zu schnellerer Regeneration, besserem Schlaf und längerer Adhärenz – also der Fähigkeit, ein Trainingssystem langfristig durchzuhalten.
Noch deutlicher wird Tsatsouline, wenn er über den Fehler des westlichen Trainingsdenkens spricht:
„Western lifters chase fatigue. We chase tension and precision.“
(„Westliche Trainierende jagen die Erschöpfung. Wir jagen Spannung und Präzision.“)
In seinem System trainierst du wie ein Kampfkünstler, nicht wie ein Bodybuilder.
Du wirst nicht „fertig“ – du wirst besser.
4. Warum sollte man Muskelkater nicht anstreben?
„No pain, no gain“ – das kennt jede*r.
Und viele halten Muskelkater noch immer für das Gütesiegel eines erfolgreichen Trainings. Aber hier kommt ein Reality-Check von Pavel Tsatsouline und Andrew Huberman:
Muskelkater ist kein Zeichen von Fortschritt – sondern von suboptimalem Reiz.
Laut Tsatsouline ist Muskelkater vor allem eines: ein Symptom für Gewebeschäden, die der Körper erst einmal reparieren muss. In seinen Augen ist das nicht nur ineffizient, sondern sogar kontraproduktiv – besonders für Menschen, die langfristig stark und gesund bleiben wollen.
„Don’t confuse soreness with progress. Confuse your muscles with precision, not punishment.“
Was bedeutet das konkret?
- Muskelkater entsteht häufig durch exzentrische Überlastung (z. B. langsames Herablassen mit hohem Gewicht).
- Dabei kommt es zu Mikrorissen, Entzündungsprozessen und reduzierter Leistungsfähigkeit – manchmal über mehrere Tage.
- Das ist nicht per se „schlecht“, aber auch nicht notwendig, um stärker zu werden.
Huberman bringt dazu die neurologische Sicht ein:
- Muskelkater erhöht die sympathische Aktivierung – also den Stresslevel.
- Das kann Schlaf, Hormonhaushalt und Regeneration verschlechtern.
- Bei chronisch überreiztem Training kann sogar die Neuroplastizität leiden – das Gehirn lernt weniger effektiv.
Tsatsoulines Gegenmodell:
Trainiere mit hoher Spannung, sauberer Technik, bewusstem Atem – aber höre auf, bevor du brennst.
Denn:
„The body grows stronger not when it’s trashed, but when it’s challenged precisely.“
Oder etwas plakativer:
Du brauchst keinen Muskelkater, um Fortschritte zu machen.
Du brauchst Nerven, die wissen, was sie tun.
5. Wie unterscheidet sich Krafttraining mit Kettlebells, Körpergewicht und Langhantel?
Jetzt wird’s praktisch:
Welche Trainingsform passt zu dir – und was empfiehlt das Strength × Longevity-Prinzip?
Kettlebells – das tragbare Nervensystem-Upgrade
Pavel Tsatsouline ist der Mann, der Kettlebells aus Russland in die westliche Welt gebracht hat. Warum?
Weil sie – richtig eingesetzt – alles abdecken, was präzises, funktionelles Krafttraining ausmacht:
- Spannung
- Atmung
- Koordination
- Explosivität
Mit Kettlebells trainierst du die gesamte Körperkette – besonders in Übungen wie:
- Swings (hintere Kette + Herz-Kreislauf-System)
- Turkish Get-Up (Ganzkörperkontrolle + Mobility)
- Clean & Press (Explosivität + Schulterstabilität)
Sie sind platzsparend, progressiv steigerbar und ideal für das Training zu Hause.
Körpergewicht – das Fundament für jede Lebensphase
Klimmzüge, Liegestütze, Kniebeugen, Planks – das klingt unspektakulär?
Ist es aber nicht.
Mit dem eigenen Körper zu arbeiten bedeutet:
- volle Kontrolle über Bewegungsqualität
- hohe Anforderung an Körperspannung & Technik
- und ideale Skalierbarkeit, gerade im Alter oder nach Verletzungen.
Für Tsatsouline ist Bodyweight-Training die Königsdisziplin:
„Master your body. Before you master the bar.“
Langhantel – für gezielten Kraftaufbau mit System
Langhanteltraining ist besonders effektiv für:
- Maximalkraft (z. B. Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken)
- strukturiertes Progressions-Training
- muskuläre & neuronale Adaption bei fortgeschrittenen Sportler*innen
Aber:
- Technisch anspruchsvoll
- Höheres Verletzungsrisiko ohne Anleitung
- Mehr Equipment nötig
Im Kontext von Longevity ist die Langhantel nicht zwingend notwendig, aber sie kann sinnvoll sein – wenn du sauber arbeitest und systematisch steigerst.
Fazit:
Tsatsouline und Huberman sind sich einig:
Das beste Tool ist das, das du regelmäßig und präzise nutzt.
- Kettlebells: vielseitig, platzsparend, nervensystemfreundlich
- Körpergewicht: skalierbar, sicher, überall machbar
- Langhantel: mächtig, aber nicht notwendig für jeden
Wichtig ist nicht das „Was“, sondern das „Wie“: Spannung. Technik. Fokus.
6. Wie trainiere ich das Nervensystem – nicht nur die Muskeln?
Wer an Krafttraining denkt, denkt oft an Muskelaufbau, schwere Gewichte und Spiegel-Selfies.
Doch was viele nicht wissen: Die eigentliche Magie passiert im Nervensystem.
Pavel Tsatsouline sagt:
„You’re not training muscles. You’re training your brain to use the muscles.“
Mit anderen Worten:
Du wirst nicht stark, weil deine Muskeln „größer“ werden.
Du wirst stark, weil dein Gehirn lernt, die Muskeln effizienter zu steuern.
🧠 Was bedeutet das konkret?
- Deine motorischen Nervenzellen senden elektrische Signale an Muskelfasern.
- Mit jedem sauberen, wiederholten Bewegungsablauf wird diese Verbindung schneller, präziser, stärker.
- Du bildest sogenannte neuromuskuläre Muster – das ist wie ein Upgrade deiner „Kraftsoftware“.
Andrew Huberman erklärt das als eine Art motorische Neuroplastizität:
- Bei präzisem Training werden Bahnen im Gehirn myelinisiert – also isoliert und „schneller geschaltet“.
- Das verbessert Kraft, Koordination, Balance und Reaktionsgeschwindigkeit – essenziell für sicheres Altern.
🔑 Wie trainierst du das Nervensystem am besten?
- Niedrige Wiederholungszahlen (z. B. 3–5 Wdh.)
- Höchste Konzentration auf Technik, Spannung, Atmung
- Langsame, bewusste Ausführung – kein Schwung, kein „Cheaten“
- Lange Pausen zwischen den Sätzen (2–5 Minuten)
- Fokus auf „Maximum Tension, Minimum Fatigue“
Ein gutes Beispiel:
Statt 10 Pull-ups „irgendwie durchzuziehen“, mach lieber 3 perfekte Wiederholungen – mit maximaler Körperspannung, bewusster Atmung und 100 % Kontrolle.
Denn so lernt dein Nervensystem zu performen, nicht zu verkrampfen.
Tsatsouline betont:
„Strength is not what you lift. It’s what you can control.“
Und Kontrolle beginnt nicht im Bizeps, sondern im Gehirn.
7. Wie lässt sich Krafttraining in den Alltag integrieren – ohne viel Zeit?
„Ich habe keine Zeit fürs Training.“
Kennen wir alle. Und oft stimmt es ja auch: Arbeit, Familie, Müdigkeit – alles gute Gründe.
Aber Tsatsouline und Huberman liefern ein System, das selbst für vielbeschäftigte Menschen funktioniert.
Und es heißt nicht: „Friss oder stirb.“
Sondern: „Finde die kleinste effektive Dosis.“
🕒 Das Prinzip der „Minimum Effective Dose“ (MED)
Pavel Tsatsouline ist kein Freund von Übertraining. Er empfiehlt lieber:
- Kurze, hochkonzentrierte Einheiten
- Wenige Wiederholungen, aber regelmäßig
- Bewegung über den Tag verteilt („Grease the Groove“)
- Kein Muskelversagen – kein Kater – keine Ausrede
Beispiel:
- Du willst stärker im Klimmzug werden?
→ Statt 3×10 bis zur Erschöpfung, mach mehrmals täglich 3 saubere Wiederholungen – mit Pause dazwischen.
→ Keine Ausrüstung nötig – nur ein Türrahmen oder ein Spielplatz.
Huberman ergänzt:
- Solche Mikro-Einheiten aktivieren das dopaminerge System – du fühlst dich wacher, klarer, fokussierter.
- Gleichzeitig belasten sie das Nervensystem kaum, was die Erholung verbessert.
- Und sie erhöhen durch Wiederholung die motorische Kompetenz, was langfristig zu echter Stärke führt.
Grease the Groove × Minimum Effective Dose – der alltagstaugliche Trainingsplan
Wenn du jetzt denkst: „Das klingt alles sinnvoll, aber wie soll ich das in meinen Alltag quetschen?“, dann kommt hier die gute Nachricht: Du brauchst kein Fitnessstudio. Kein 60-Minuten-Workout. Kein Muskelversagen.
Was du brauchst, ist ein klug dosiertes, regelmäßiges System. Und das bekommst du mit dem Prinzip:
Was heißt das?
- Grease the Groove (GTG) bedeutet: Du wiederholst eine Bewegung mehrfach über den Tag verteilt, aber immer unterhalb deiner maximalen Leistungsgrenze.
- Minimum Effective Dose (MED) bedeutet: Du trainierst nur so viel, wie nötig, um eine Anpassung zu erreichen – nicht mehr.
Kombiniert ergibt sich ein System, das:
- dein Nervensystem statt dein Ego trainiert
- regelmäßig kleine Reize setzt, statt unregelmäßig große
- sich perfekt in den Alltag integrieren lässt
Die Regeln für effektives GTG-Training:
| Prinzip | Empfehlung |
|---|---|
| Bewegungsauswahl | 2–3 Grundübungen pro Tag (z. B. Push-up, Pull-up, Pistol Squat) |
| Reps pro Satz | ca. 40–60 % deines Maximums |
| Sätze pro Tag | 4–6 Sätze, über den Tag verteilt |
| Pausen zwischen den Sätzen | Mind. 1 Stunde – kein klassisches Workout, sondern verteilt über Alltag |
| Technik & Spannung | Höchste Priorität: saubere Ausführung, volle Kontrolle |
| Skalierung | Übungen können vereinfacht oder erschwert werden |
Dein Wochenplan: GTG + MED für Stärke im Alltag
Fokus: Push (Drücken) · Pull (Ziehen) · Squat (Beine) · Core (Körperspannung)
| Tag | Push | Pull | Squat | Core / Spannung |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Incline Push-ups | Dead Hang (Hängen) | Assisted Pistol Squats | Plank (30–60 s) |
| Dienstag | Normale Push-ups | Negative Pull-ups | Pistol Squats ohne Zusatz | Hollow Hold / Rocks |
| Mittwoch | Pause oder Mobility | |||
| Donnerstag | Elevated Push-ups | Klimmzüge (3–5 Reps) | Weighted Pistol Squats | Side Plank (je Seite) |
| Freitag | Pause oder Yoga | |||
| Samstag | Push-up-Variante frei | Pull-up-Variante frei | Squat-Variante frei | Core: V-Ups, L-Sit etc. |
| Sonntag | Optional: 1 Satz/Bewegung | oder Spaziergang + Hang |
Realistische Trainingsdosierungen pro Tag:
| Übung | Beispiel-Maximum | GTG-Satzdosis | Zielvolumen / Tag |
|---|---|---|---|
| Push-Ups | 20 Reps | 5–8 Reps | 30–50 Reps |
| Klimmzüge | 6 Reps | 2–4 Reps | 15–25 Reps |
| Pistol Squats (pro Bein) | 8 Reps | 3–5 Reps | 30–50 Reps |
| Dead Hang (Griffkraft) | 30 Sek. | 20 Sek. | 3–5 Sets |
| Plank / Core Holds | 1 Min+ | 30–60 Sek. | 3–4 Sets |
→ Wichtig: Die Wiederholungszahlen sind Richtwerte. Entscheidend ist, dass du immer unter deiner maximalen Kapazität bleibst, um das Nervensystem zu stimulieren – nicht zu erschöpfen.
Skalierbarkeit: So passt du den Plan an dein Level an
| Bewegung | Regression (leichter) | Progression (schwerer) |
|---|---|---|
| Push-Up | Incline, Knie, negatives Tempo | Feet Elevated, Explosiv, Rucksack |
| Klimmzug | Band, negatives, Dead Hang | Weighted Pull-Ups, L-Sit Pull-ups |
| Pistol Squat | Teilbewegung, Stuhl als Hilfe | Zusatzgewicht, langsame Exzentrik |
| Core | Auf Knien, kürzer halten | Weighted Plank, L-Sit, Dragonflag |
Fazit: Alltagsstärke – ganz ohne Workout-Stress
Stell dir vor, du wirst stärker – ohne je außer Atem zu geraten.
Dein Körper wird widerstandsfähiger, koordinierter, aufrechter – und dein Nervensystem lernt, effizient zu feuern, jeden Tag ein bisschen besser.
Das ist Strength × Longevity im Alltag:
Und das Beste: Es passt in dein Leben – statt dein Leben drumherum zu bauen.
Aber wichtig:
Auspowern – also bis an die muskulären oder metabolischen Grenzen zu gehen – hat ebenfalls seinen Platz.
Es trainiert vor allem deine Belastungstoleranz, dein Herz-Kreislauf-System und deine mentale Widerstandsfähigkeit.
Nur: Es ist nicht dasselbe wie neurologisches Krafttraining. Und es braucht mehr Erholung.
Beides hat seinen Platz – nur zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlichen Zielen.
8. Was bedeutet eigentlich Strength × Longevity?
„Stark werden“ und „alt werden“ wirken auf den ersten Blick wie zwei komplett unterschiedliche Ziele. Das eine klingt nach Hanteln, das andere nach Hörgerät.
Aber was passiert, wenn man beides zusammendenkt?
Strength × Longevity bedeutet:
→ Krafttraining nicht als Selbstzweck zu sehen,
→ sondern als Basis für ein langes, selbstbestimmtes und gesundes Leben.
Denn was bringt es, 90 zu werden, wenn du ab 70 nicht mehr aus dem Stuhl kommst?
Oder deinen Einkauf nicht mehr heben kannst?
Oder geistig abbauen musst, weil du dich nicht mehr bewegst?
Pavel Tsatsouline nennt Kraft die „Mutter aller physischen Fähigkeiten“ – und Andrew Huberman liefert die Neurowissenschaft dazu:
- Krafttraining hält Nervensystem, Hormonhaushalt, Gehirn und Muskeln aktiv
- Es verbessert Stoffwechsel, Reaktionsgeschwindigkeit und Regenerationsfähigkeit
- Und es bremst biologische Alterungsprozesse, ohne radikale Diäten oder Pillen
Strength × Longevity ist damit ein neues Paradigma:
Nicht „entweder jung & stark oder alt & schwach“.
Sondern: Stark bleiben – während du älter wirst.
Und das Beste: Du kannst jederzeit anfangen.
9. Was können wir von russischer Trainingsmethodik lernen?
Tsatsouline ist nicht nur ein charismatischer Typ mit sowjetischem Akzent – er ist das Ergebnis jahrzehntelanger russischer Trainingskultur, die sich stark von westlicher Fitnesslogik unterscheidet.
Hier einige Grundsätze, die aus dem russischen System stammen – und die Tsatsouline in den Westen gebracht hat:
| Westliche Fitness | Russische Trainingsphilosophie |
|---|---|
| „No pain, no gain“ | „Trainiere sauber, nicht kaputt“ |
| Muskelversagen = Erfolg | Muskelkontrolle = Erfolg |
| Maximales Volumen | Minimale effektive Dosis |
| Fokus auf Muskeln | Fokus auf das Nervensystem |
| Ständig neue Reize | Meistere die gleichen Bewegungen |
| Fortschritt = Gewicht | Fortschritt = Spannung + Präzision |
In Russland trainieren Sportler*innen wie Musiker – mit Wiederholung, Gefühl für Technik, bewusstem Umgang mit dem eigenen Körper.
Klingt weniger heroisch.
Funktioniert dafür oft besser – und deutlich länger.
Gerade für Krafttraining im Alter ist diese Herangehensweise Gold wert:
- Kein Zwang zur Erschöpfung
- Weniger Verletzungen
- Länger durchführbar
- Psychologisch angenehmer
Oder wie Tsatsouline sagt:
„Discipline is freedom. Consistency is power.“
10. Ist es je zu spät, mit Krafttraining zu beginnen?
Nein.
Wirklich: Nein.
Wenn du glaubst, du bist „zu alt“, dann ist genau jetzt der perfekte Zeitpunkt, das Gegenteil zu beweisen.
Denn Studien zeigen klar:
- Auch Menschen über 70 können noch signifikant Muskeln aufbauen,
- ihre Gehgeschwindigkeit und Koordination verbessern,
- und sogar das Sturzrisiko halbieren – mit regelmäßigem, einfachem Krafttraining.
Und nein – du musst nicht ins Gym.
Du brauchst keine Kniebeugen mit 100 Kilo.
Aber du brauchst: Bewegung gegen Widerstand.
Das kann dein Körpergewicht sein. Ein Rucksack. Eine Kettlebell. Oder ein Türrahmen.
Das Entscheidende ist:
- Regelmäßigkeit
- Technik vor Gewicht
- und das Verständnis, dass dein Nervensystem formbar bleibt – bis ins hohe Alter
Andrew Huberman beschreibt das so:
„Neuroplastizität hört nicht auf – sie verändert nur ihren Kontext.“
Und Tsatsouline würde es vermutlich so sagen:
„If you can breathe, you can train.“
Also: Fang an. Heute. Und wenn du schon dabei bist: Mach es für die nächsten 40 Jahre.
Quellen:
und das Youtube-Video. sehr empfehlenswert.
auch spannend auf Huberman-Basis: Fett verlieren mit Wissenschaft – Die Erkenntnisse aus dem Huberman Lab Podcast – Biohacking Wiki – Tiefgreifendes Wissen über effektive Biohacks